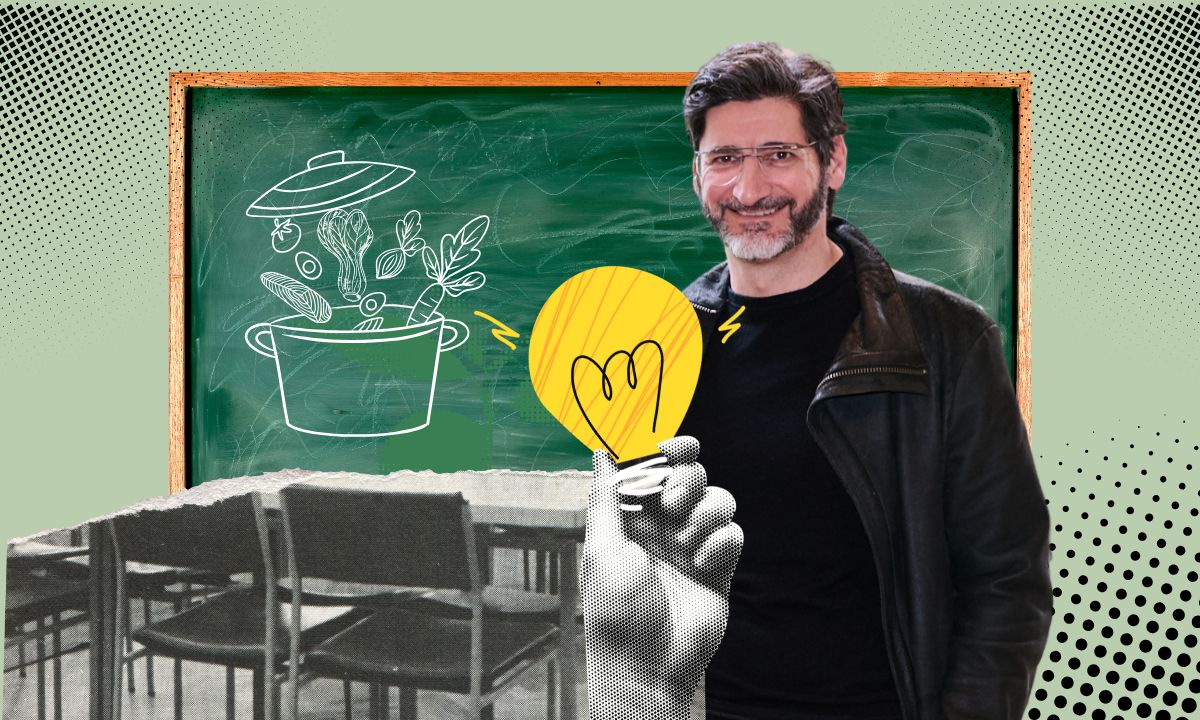Sie könnte das gastronomische Berufsbild revolutionieren. Die vegetarische Kochlehre, die im Juli in Österreich startete, ist die erste Ausbildung dieser Art – weltweit wohlgemerkt. Jahrelang kämpften Köch:innen wie Paul Ivić und Parvin Razavi vermeintlich erfolglos für ein solches Modell. 2023 versetzte ein Antrag von Gastronom:innen- und Grüne-Wirtschaft-Vertreter Joachim Ivany beim Arbeitsministerium dem Stein den letzten, entscheidenden Stoß, um ihn endgültig ins Rollen zu bringen. Was folgte, waren lange Diskussionen, Verzögerungen, gar eine Petition. Aufhalten ließ sich der Stein jedoch nicht mehr: Ende 2024 unterzeichnete der damalige Arbeitsminister Martin Kocher die Verordnung.
Zwischenziel erreicht. Aber wie sieht die Realität in den Küchen aus, die diese Vision bereits heute leben? Parvin Razavi aus dem &flora und Paul Ivić aus dem TIAN zählen zu den Pionierbetrieben – und blicken konstruktiv-kritisch auf den Start dieser neuen Ausbildung.

Bewusste Entscheidung, nicht Modetrend
Es war nach den vielen öffentlich geführten Debatten abzusehen: An Interessierten mangelt es nicht. Das können beide Betriebe bestätigen: Im Restaurant TIAN gingen bereits 16 Bewerbungen ein – ausschließlich von Erwachsenen über 18 Jahren. Für Ivić ist das ein klares Signal: „Sie kommen nicht, weil sie ‚irgendwas mit Kochen‘ machen wollen, sondern weil sie darin eine echte Perspektive sehen – für sich persönlich und für die Zukunft unseres Essenssystems.“ Auch bei Parvin Razavi haben sich mehrere Personen beworben, darunter eine Bewerberin aus Deutschland, die gezielt in das neue System wechseln möchte.
„Wenn wir diese Ausbildung als lebendiges System verstehen, das offen für Anpassung, Weiterentwicklung und Innovation ist, dann kann sie ein Meilenstein werden.“
Zentrales Anliegen beider Köch:innen: Die vegetarische Kochlehre darf kein bloßer Abklatsch der klassischen Ausbildung sein. Razavi betont: „Uns geht es nicht darum, einfach nur Fleisch durch pflanzliche Alternativen zu ersetzen.“ Vielmehr brauche es eine eigenständige Ausbildung, „ökologisch, vielfältig, fundiert und handwerklich hochwertig“.

Einen neuen Ansatz, wie auch Ivić befindet: „Es sollte nicht darum gehen, Fleisch einfach durch Tofu zu ersetzen – sondern darum, ganzheitlich zu denken: Geschmack, Sortenvielfalt, Nachhaltigkeit, Handwerk.“ Die Basis für eine solche Ausbildung sei jedoch in vielen Betrieben und Schulen noch nicht vorhanden. „Viele Ausbildungsbetriebe sind noch nicht darauf vorbereitet, jungen Menschen eine vollwertige pflanzliche Küche beizubringen – mit all ihren Techniken, Produkten und ökologischen Zusammenhängen.“

Kritik am aktuellen Lehrplan
Dementsprechend kritisch sehen beide die aktuelle Lehrplangestaltung. Der sei noch stark von der traditionellen, fleischbasierten Küche geprägt. Razavi: „Eine vegetarische Rindsroulade ist aus unserer Sicht kein Fortschritt, sondern ein Missverständnis.“ Sie fordert stattdessen: „Die Vielfalt pflanzlicher Küche liegt gerade nicht in traditionellen Umdeutungen, sondern in neuen Ideen, Techniken und Zugängen.“
„Wir müssen also nicht nur die Lehrpläne ändern, sondern auch die Köpfe.“
Es brauche Wissen zu Geschmacksaufbau ohne tierische Fonds, zur Arbeit mit Texturen, Fermentation oder Reifegraden – und den Mut, diese Inhalte auch zu lehren. Ivić sieht hier einen großen Schulungsbedarf: „Wir müssen also nicht nur die Lehrpläne ändern, sondern auch die Köpfe. Und dafür braucht es Begleitung, Schulung, Ressourcen.“
Modular denken, klar kommunizieren
Die Küchenchefin des &flora plädiert für ein neues Strukturmodell der Lehre: „Ein ein- bis zweijähriges Grundmodul, gefolgt von einer Spezialisierung wie etwa auf vegane oder vegetarische Küche.“ Damit könne man sowohl kulinarisches Basiswissen als auch tiefergehende pflanzliche Kompetenzen vermitteln.
„Echte Veränderung beginnt nie da, wo alle schon einverstanden sind.“
Zugleich fordern beide klare Rahmenbedingungen für Betriebe und Lehrlinge: Welche Kriterien müssen Betriebe erfüllen? Wie sieht der Berufsschulalltag konkret aus? Wo finden die Lehrgänge statt? Hier herrscht aus ihrer Sicht noch viel Unklarheit – mit negativen Folgen für Planungssicherheit und Ausbildungsqualität.
Aufbruch mit Verantwortung
Trotz aller Kritik: Es überwiegt die Aufbruchsstimmung. Ivić bringt es auf den Punkt: „Echte Veränderung beginnt nie da, wo alle schon einverstanden sind.“ Der gebürtige Tiroler sieht in der neuen Lehre eine große Chance, die über die Küche hinaus wirkt: „Wenn wir es richtig machen, bringt diese Ausbildung eine neue Generation von Köch:innen hervor, die mit der Natur arbeiten, Herkunft spürbarer machen und die in ihrem Tun auch einen Sinn und Freude sehen.“
An den Mut zur Weiterentwicklung appelliert auch seine Kollegin: „Wenn wir diese Ausbildung als lebendiges System verstehen, das offen für Anpassung, Weiterentwicklung und Innovation ist, dann kann sie ein Meilenstein werden. Nicht nur für unsere Küche, sondern für unser gesamtes Verständnis von Ernährung und Handwerk.“